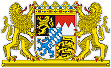Einleitung
Vgl. allg. das Vorwort zum Bestand "Hauptkammer Ansbach, Sachakten"!
Die Entnazifizierung in Bayern wurde am 5. März 1946 durch das Kontrollratsgesetz Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus auf eine gesetzmäßige Basis gestellt. Nach Monaten teilweise improvisierter und unkoordinierter Arbeitsverbote und Verhaftungen durch die amerikanischen Besatzungsbehörden wurden die Maßnahmen infolge der Unterzeichnung des Gesetzes durch die Ministerpräsidenten der Länder der US-Zone reguliert. Das Gesetz intendierte die Erfassung und Registrierung aller früheren Mitglieder der NSDAP und deren Nebengliederungen mit Hilfe von Meldebögen, die von allen Deutschen über 18 Jahre ausgefüllt werden mussten. Auf Grundlage der Bögen stellten die als Sonderverwaltungsgerichte neu geschaffenen Spruchkammern die Schuldigkeit der Angeklagten fest und ordneten sie je nach Schwere der Vergehen in eine der fünf Gruppen ein: I. Hauptschuldige, II. Belastete, III. Minderbelastete, IV. Mitläufer und V. Entlastete. Das Gesetz listete genau auf, welche Ränge in welchen Gliederungen und Organisationen welcher Kategorie zuzuordnen und welche Sühnemaßnahmen zu verhängen waren. Für die Gruppen I bis III kamen Einweisung in Arbeitslager, Einziehung des Vermögens, Pensionsverlust, Gehaltskürzungen, Arbeitsbeschränkungen und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte in Frage, für die Mitläufer Geldbußen. Die Fälle der Belasteten der Gruppen I und II wurden mündlich und öffentlich, die der anderen schriftlich verhandelt.
Die Spruchkammern bestanden aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzern. Außerdem war bei jeder Kammer ein Kläger bestellt. Der sehr langsam vorangehende Aufbau des Spruchkammerapparats, einer Laienbürokratie mit schöffengerichtlicher Verfassung, wurde in erster Linie von den inzwischen zugelassenen Parteien getragen, die in der Anfangszeit entsprechend dem parteipolitischen Proporz dort vertreten waren. Die Vorstellung des Gesetzes, wonach die Vorsitzenden die Befähigung zum Richteramt haben sollten, ließ sich meist nicht verwirklichen. Noch Mitte September 1946 waren von den Vorsitzenden und Klägern erster Instanz nur 5 % Juristen. Zur Unterstützung der Spruchkammern wurden auch eigene Ermittler bestellt, die Material über die Betroffenen sammelten. Bei der Bahn- und Postverwaltung und im Bereich des Kultusministeriums bildete man Fachausschüsse, die ebenfalls Material zusammentrugen.
In jedem Landkreis wurde mindestens eine Spruchkammer eingerichtet. In Mittelfranken waren dies die Spruchkammern Ansbach-Stadt bzw. -Land, Dinkelsbühl, Eichstätt, Erlangen-Stadt bzw. -Land, Feuchtwangen, Fürth-Stadt (I-II) bzw. -Land, Gunzenhausen-Stadt bzw. -Land, Hersbruck, Hilpoltstein, Lauf a.d. Pegnitz, Neustadt a.d. Aisch, Nürnberg-Stadt (I-VII) bzw. -Land, Nürnberg-Lager (Langwasser), Rothenburg o.d. Tauber, Scheinfeld, Schwabach, Uffenheim, Weißenburg und Windsheim. Ferner wurden in Ansbach und Nürnberg zwei Berufungskammern als höhere Instanzen etabliert. Als höchste Instanz diente der Kassationshof beim neu geschaffenen Staatsministerium für Sonderaufgaben. Dieser war jedoch kein Gerichtshof, sondern übte die Rechte des Sonderministers aus, indem er die Überprüfung und Revision von Fällen veranlasste. Auch die oberste Aufsicht und der Aufbau der Spruchkammern fielen in die Zuständigkeit des Sonderministers.
Aufgrund politischer Kontroversen zwischen Amerikanern und Deutschen sowie immer stärker werdenden Bestrebungen innerhalb der im bayerischen Landtag vertretenen Parteien zur sozialen Reintegration der politisch Belasteten schwächte sich die Entnazifizierung bald ab und war schon im Sommer 1948 faktisch beinahe beendet. Die 31 mittelfränkischen Spruchkammern wurden zum 1. Januar 1949 zu den beiden Hauptkammern Ansbach und Nürnberg zusammengefasst, und am 1. September 1949 wurde auch die Ansbacher Kammer aufgelöst. Die Hauptkammer Nürnberg wurde in der Folge zu einer Dienststelle der Hauptkammer München umgewandelt und ihre Arbeit zum 31.12.1950 ebenfalls endgültig eingestellt.
Bis zum 31. Dezember 1949 hatte man in Bayern die Fragebögen von 6.780.188 Personen bearbeitet. Davon waren 72 % vom Gesetz nicht betroffen; betroffen und von den Spruchkammern behandelt waren demnach rund 28 %. 99,9 % der Fälle waren in erster Instanz erledigt worden; von diesen fielen 28 % unter die Jugend- und 52 % unter die Weihnachtsamnestie. 80.139 Personen (15 %) wurden in eine der fünf Kategorien eingereiht. 15 % von ihnen wurden als entlastet eingestuft, 0,3 % waren Hauptschuldige, 4 % Belastete, 19 % Minderbelastete und 77 % Mitläufer.
Das Staatsarchiv Nürnberg unter der Leitung des damaligen Direktors Solleder hatte bereits während der laufenden Verfahren auf den Erhalt der Spruchkammerüberlieferung ein starkes Augenmerk gerichtet. Doch erst nach Ablauf der 50-jährigen Aufbewahrungsdauer bei den Amtsgerichten (vgl. Schreiben des Bayer. Staatsministeriums der Justiz v. 29.10.1979) konnte ab dem Jahr 2000 mit der Übernahme der entsprechenden Bestände begonnen werden.
Die Spruchkammer Ansbach-Land hatte ihren Sitz im Landgerichtsgebäude (vgl. StAN, Registratur des Staatsarchivs Nürnberg 495, Adressverzeichnis vom November 1948). Die Verfahrensakten der Spruchkammer Ansbach (Stadt und Land) wurden 2002 vom Amtsgericht Ansbach ans Staatsarchiv Nürnberg abgegeben (Handakt 106-11).
Die personenbezogenen Sperrfristen für die Onlinestellung der Spruchkammerakten des Staatsarchivs Nürnberg wurden durch den Datenschutzbeauftragten der Staatlichen Archive Bayerns 2023 verkürzt auf 90 Jahre nach Geburt (Gz. 5031-5/4/31).
Literatur
Lutz Niethammer, Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, Berlin/Bonn 1982
Paul Hoser, Entnazifizierung, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_46003> (22.04.2013)
Ulrich Schuh: Die Entnazifizierung in Mittelfranken. Vorhaben, Umsetzung und Bilanz des Spruchkammerverfahrens in einer vielfältigen Region. Nürnberg 2013