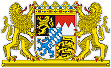Einleitung
I. Bemerkung zur Geschichte der Kreisbauernschaften
Der Reichsnährstand wurde mit Gesetz vom 13. September 1933 als SelbstverwaItungskörperschaft der Agrarwirtschaft gegründet. Seiner Entstehung war die Gleichschaltung aller landwirtschaftlichen Interessensverbände vorangegangen. Der Reichsnährstand untergliederte sich in 28 Landesbauernschaften, die wiederum in Kreisbauernschaften unterteilt waren. So war, um ein Beispiel anzuführen, der Landesbauernschaft Bayern (ab dem 15. Oktober 1938 der Landesbauernschaft Bayerische Ostmark) die Kreisbauernschaft Hof untergeordnet. Bindeglied zu den Landwirten vor Ort war der Ortsbauernführer.
Das Ziel des Reichsnährstandes war die Zusammenschließung der Bauern in einem Zwangskartell, um einen einheitlichen landwirtschaftlichen Berufsstand zu schaffen. Mittels der „Blut und Boden“-Ideologie sollte der Reichsnährstand im Deutschen Reich etabliert werden: Der Bauer war der Ursprung der Autarkie-Politik Hitlers. Er wurde instrumentalisiert, um damit die imperialistischen Expansionsbestrebungen zu rechtfertigen. In der Ideologie nahm das Bauerntum einen privilegierten Stellenwert ein. Das Landleben wurde glorifiziert. Hinter dieser Propaganda standen wirtschaftliche Bestrebungen, wie etwa das Volk in der angestrebten Kriegszeit versorgen zu können (Vierjahresplan) oder die Gleichschaltung der Gesellschaft, um sie in das nationalsozialistische System zu integrieren und zu kontrollieren. Dies mündete in die Verstaatlichung der Landwirtschaft.
Neben der Vermittlung der „Blut und Boden“-Ideologie sollte durch den Reichsnährstand der institutionelle Rahmen geschaffen werden, um die landwirtschaftliche Situation der Bauern zu verbessern. Mittels höherer Importzölle, Senkung von Agrarkrediten, Maßnahmen gegen Zwangs-versteigerungen überschuldeter Betriebe und dem Schutz der Erbhöfe galt es, die agrarwirtschaftlichen Erträge zu optimieren. Zu den Aufgaben der Kreisbauernschaften gehörte es, diese politischen Vorgaben umzusetzen. Damit kam ihnen auch die Funktion der Erbhofüberwachung zu. Die Bedeutung des mit Gesetz vom 23. September 1933 geschaffenen Erbhofes lag in seiner Unteilbarkeit. Er konnte nur von einer Person geerbt werden, die einen „großen Abstammungs-nachweis“ (Ariernachweis) erbrachte. Dieses bäuerliche Erbrecht wurde wiederum von einer weiteren Unterbehörde durchgesetzt - dem Anerbengericht.
II. Aufgabe und Funktion der Kreisbauernschaften
Zu den wichtigsten Aufgaben der Kreisbauernschaften gehörten die Sicherstellung der von den einzelnen Erbhöfen an die Gemeinden abzugebenden landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Überwachung der finanziellen Zuweisungen anhand der Berichte der Hofbegehungskommissionen, die Erstellung von Gutachten über einzelne Höfe und deren Besitzer sowie die Führung der Marktleistungskartei. Im Aktenbestand Kreisbauernschaften spiegeln sich folgende Aufgaben-bereiche wider: die Feststellung der Bauernfähigkeit (§§ 18, 48 REG) oder bei der Feststellung der Bauernunfähigkeit die Bestimmung und Einsetzung eines Treuhänders, die Anordnung des Anerben (§ 21, Abs. 3, 25 und 49 REG) sowie die Prüfung der Besitz- und Vermögensverhältnisse, z. B. bei Veräußerungen, Teilungen und Hypothekenbestellungen (§§ 37, 49 REG). Leider fehlt in der Überlieferung völlig die durch die Kreisbauernschaften kontrollierte Zwangsbewirtschaftung und Abgabenfestlegung, z.B. die Marktfestsetzungslisten. Der gesamte Aufgabenbereich der Kreisbauernschaft mündete in eine Kontrolle aller Belange der Bauern, weit über den landwirt-schaftlichen Bereich hinaus.
III. Hinweise auf die inhaltliche Überlieferung und Bestandsbildung
Die von den Kreisbauernschaften vorliegenden Akten wurden in den 60er und 70er Jahren von den Ämtern für Landwirtschaft übernommen. Auf Grund ihrer Provenienz wurden sie aus dem Bestand der Landwirtschaftsämter genommen und als eigener Fonds „Kreisbauernschaften“ im Reichsnährstand aufgestellt. Vorhanden sind ausschließlich hofbezogene Akten, die nach Orten als Sammelakten zusammengelegt worden sind.
Die Aufnahme des Bauernhofs in die Erbhöferolle erfolgte beim Anerbengericht. Dessen Über-lieferung ist heute Bestandteil der amtsgerichtlichen Bestände im Staatsarchiv Bamberg. Jedoch findet sich ausnahmslos in jeder geführten Erbhofakte der Kreisbauernschaften ein Auszug aus der Erbhöferolle wieder. Aus diesem gehen der Besitzer des Erbhofes, die Anschrift und der Hof mit seinen Bestandteilen hervor. Da jeder Erbhof durch Verordnung schuldenfrei zu sein hatte, wurden in vielen Fällen Entschuldungsverfahren angestrengt. Diese spiegeln sich sowohl in den vorliegenden Akten als auch in jenen der Entschuldungsämter, die ebenfalls in der amtsgerichtlichen Überlieferung zu suchen sind.
IV. Benützung
Da es sich beim vorliegenden Schriftgut der Kreisbauernschaften in der Regel um personenbezogene Unterlagen nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz handelt, ist eine Vorlage dieser Akten nur innerhalb der durch Art. 10 Abs. 3 und Abs. 4 des Bayerischen Archivgesetzes (GVBI. 1989, S. 710-713) vorgegebenen Grenzen möglich. Danach darf personenbezogenes Archivgut in der Regel erst "10 Jahre nach dem Tod des Betroffenen benützt werden. Ist der Todestag nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand festzustellen, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach der Geburt des Betroffenen. ..."
Eine Verkürzung dieser Schutzfristen kann schriftlich beim Staatsarchiv Bamberg nach § 6 der Archivbenützungsordnung für die staatlichen Archive Bayerns (ArchivBO, GVBI. 1990, S. 6-8) beantragt werden, wenn die Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder wenn nachgewiesen werden kann, "dass die Benützung zur Erreichung des beabsichtigten wissenschaftlichen Zwecks, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der abgebenden Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist".
Bei der Schutzfristverkürzung handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, über dessen Genehmigung die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns mit Zustimmung der abgebenden Behörde entscheidet. Der schriftliche Antrag sollte deshalb fundiert begründet und mit entsprechenden Nachweisen versehen sein (z. B. Bestätigung der Lehreinrichtung bei „wissenschaftlichen Zweck“). Er ist beim Staatsarchiv Bamberg rechtzeitig einzureichen, da das beschriebene Genehmigungs¬verfahren wegen der gebotenen Verfahrensabläufe (Zustimmung der Abgabebehörde bzw. des Rechtsnachfolgers müssen eingeholt werden) erfahrungsgemäß sehr aufwändig ist. Mit längeren Bearbeitungszeiträumen sollte deshalb gerechnet werden.
V. Literatur
Bachmann, Christoph: Blut und Boden - Zur Herrschafts- und VerwaItungsgeschichte des Reichsnährstandes in Bayern, in: Rumschöttel, Hermann, Ziegler, Walter (Hg.): Staat und Gaue in der NS – Zeit, Bayern 1933-1945, München 2004, S. 621-650.
- Benz, Wolfgang, Graml, Hermann, Weiß, Hermann (Hg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus, München 1997.
- Brackmann, Karl - Heinz, Birkenhauer, Renate: NS - Deutsch, „Selbstverständliche“ Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus, Darmstadt 1988.
- Hofmann, Hanns Hubert: Unterfranken, Geschichte seiner VerwaItungsstrukturen seit dem Ende des Alten Reiches 1814 bis 1980, Würzburg 1981.
- Volkert, Wilhelm (Hg.): Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte, 1799 – 1980, München 1983.