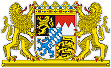Einleitung
1. Verbandsgeschichte
(in enger Anlehnung an:
- www.kuvb.de/wir-ueber-uns/geschichte (aufgerufen am 22.05.2017)
- Jahresbericht 2011 Bayer. GUVV, Bayer. LUK und UKM (http://www.kuvb.de/fileadmin/daten/bilder/Jahresbericht/KUVB_JB_2011_www.pdf) (aufgerufen am 22.05.2017))
1884 wurde die gesetzliche Unfallversicherung eingeführt. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben seitdem Anspruch auf öffentlich-rechtliche Entschädigung, die Haftpflicht des Unternehmers für Personenschäden ihrer Beschäftigten nach Unfällen im Betrieb entfällt. 1892 richtete die Landeshauptstadt München eine kommunale Eigenunfallversicherung (Unfallkasse München (UKM)) ein, die bis zur Fusion mit dem späteren Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverband (Bayer. GUVV) zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) im Jahr 2012 Bestand hatte. Zum 1. Januar 1895 wurde der "Unfallversicherungsverband der bayerischen Gemeinden, Bezirke und Kreise" eingerichtet. Dieser erste kommunale Unfallversicherungsverband Deutschlands entstand durch den Zusammenschluss von 23 Städten, 226 Distrikten und 5.662 Gemeinden unter dem Dach der Obersten Baubehörde. Seit 1925 ist rechtlich auch der Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstelle in den gesetzlichen Versicherungsschutz einbezogen. Im Dezember 1928 wurden die Eigenunfallversicherungen der Gemeindeverbände zu Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigenständiger Selbstverwaltung erklärt. Der "Unfallversicherungsverband der bayerischen Gemeinden, Bezirke und Kreise" erließ daraufhin eine Satzung und zog am 1.8.1929 in ein eigenes Gebäude um. Seit dem 1.1.1932 nimmt der "Unfallversicherungsverband der bayerischen Gemeinden, Bezirke und Kreise" zugleich auch die Aufgaben der Staatlichen Ausführungsbehörde (StAfU - später Bayerische LUK) wahr. Diese Verwaltungs- und Personalunion besteht bis heute. Zum 10.1.1940 erfolgte die Umbenennung des "Unfallversicherungsverbands der bayerischen Gemeinden, Bezirke und Kreise" in "Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband" (Bayer. GUVV). 1963 wurde der versicherte Personenkreis ausgeweitet, unter anderem auf Ehrenamtliche und auf Organspender. Seit dem 18.3.1971 sind Schüler, Studierende und Kinder in Kindergärten genauso umfassend abgesichert wie Arbeitnehmer. 1997 wurde der Kreis der Abgesicherten wiederum erweitert, und zwar um Kinder in Horten, Tageseinrichtungen und vor- und nachschulischen Betreuungsmaßnahmen. Zum 1.1.2012 schließlich fusionierten der Bayer. GUVV und die Unfallkasse München (UKM) zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB). Die KUVB ist seitdem die Rechtsnachfolgerin der UKM und des Bayer. GUVV. Zusammen mit der weiterhin in Verwaltungs- und Personalunion geführten Bayerischen Landesunfallkasse (Bayer. LUK) betreut die KUVB derzeit über fünf Millionen Versicherte in Bayern und sorgt für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, in Schulen, Kindertageseinrichtungen, Universitäten oder bei ehrenamtlichem Engagement.
2. Verbandsorganisation
(siehe oben Fußnote 1: Jahresbericht 2011 Bayer. GUVV, Bayer. LUK und UKM und die Satzungen von KUVB und LUK (aufgerufen am 22.05.2017):
- www.kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/RFOE/Satzung/77320_Satzung_KUVB_2014_web.pdf
- www.kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/RFOE/Satzung/72790_Satzung_LUK_2014_web.pdf)
Die KUVB (Kommunale Unfallversicherung Bayern) ist zuständig für die Unternehmen (Verwaltungen, Anstalten, Einrichtungen und Betriebe) der Gemeinden und Gemeindeverbände, während die Bayer. LUK (Bayerische Landesunfallkasse) analog dazu für die Unternehmen des Freistaates Bayern zuständig ist. Die Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung sind im Sozialgesetzbuch VII festgelegt und gliedern sich in die Bereiche Prävention, Leistungen zur medizinischen, beruflichen oder sozialen Rehabilitation sowie Gewährung von Entschädigungen bei schwerwiegenden Unfallfolgen oder Erkrankungen.
Die KUVB und die Bayer. LUK sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Selbstverwaltung wird von den Versicherten und den Arbeitgebern ausgeübt. Beide Unfallversicherungsträger haben als Selbstverwaltungsorgane jeweils eine Vertreterversammlung und einen Vorstand. Die Organe setzen sich je zur Hälfte aus Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber zusammen. Die Mitglieder der Organe üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane werden alle sechs Jahre in Sozialversicherungswahlen gewählt. Die Vertreterversammlung der KUVB bzw. der Bayer. LUK beschließt die Satzung und sonstiges autonomes Recht des jeweiligen Unfallversicherungsträgers. Sie vertritt aber auch den Versicherungsträger gegenüber dem Vorstand und dessen Mitgliedern. Nicht zuletzt werden von der Vertreterversammlung Ausschüsse gebildet, die Beschlüsse vorbereiten oder einzelne Aufgaben erledigen (Präventionsausschuss, Wahlausschuss, Haushaltsausschuss, Widerspruchsausschüsse, Rentenausschüsse). Die Vertreterversammlung tritt zweimal jährlich zusammen und nimmt hierbei vor allem die Jahresrechnung ab und entlastet die Vorstände und Geschäftsführer.
Der Vorstand verwaltet den Versicherungsträger und vertritt ihn gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand wählt den/die Vorsitzende, benennt die Delegierten bei der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes DGUV e.V. ("Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.") und bereitet die Beschlüsse der Vertreterversammlung vor. Der Vorstand der KUVB befasst sich zudem mit Personalangelegenheiten.
Der Geschäftsführer führt hauptamtlich die laufenden Verwaltungsgeschäfte und vertritt den Versicherungsträger insoweit gerichtlich und außergerichtlich. Er gehört den Vorständen mit beratender Stimme an und ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte des Personals. Der Geschäftsführer und sein Stellvertreter werden auf Vorschlag des Vorstandes der KUVB von der Vertreterversammlung gewählt und sind zugleich auch Geschäftsführer der Bayer. LUK (Personalunion).
3. Überlieferungsgeschichte (vgl. Aktenvermerk Gz. 1345/105-7.6.3 (26.02.2010) von Frau Dr. Scherr) und Bestandsgehalt
3.1 Archivierungsvertrag
Im Jahr 2010 nahmen der Bayer. GUVV und das BayHStA zum ersten Mal Kontakt zueinander auf, und nur kurze Zeit später, im Dezember 2010/Januar 2011, wurde der Archivierungsvertrag abgeschlossen. Dem BayHStA wurden für den Zeitraum bis 1962 alle Leistungsakten sowie bis 1945 zusätzlich die Unfallverzeichnisse überlassen. Als Stichprobe aus den Leistungsakten der Zeit nach 1962 sollen dem BayHStA die Akten der an einem 10., 11. oder 12. Mai geborenen Versicherten bzw. Verletzten überlassen werden (Hintergrund: Das Bundesarchiv wendet dasselbe Auswahlkriterium an). Pro Jahrgang sind darüber hinaus weitere 20 bis 40 Leistungsakten anzubieten, die aus offensichtlichem Grunde (Fallbesonderheit, Schadenssumme, Zeitgeschichte) besondere Bedeutung besitzen. An weiteren Unterlagen sind dem BayHStA anzubieten: Satzungen, Geschäftsberichte, Jahresberichte und Organisations-/Geschäftsverteilungspläne, ausgewählte Personalakten der Bediensteten, Versammlungsprotokolle, Jahresabschlüsse, Unfallverzeichnisse, Dokumentationsmaterial (Plakate, Flugblätter, Eigenpublikationen etc.) und sonstige Unterlagen, die aus der Sicht des Unfallversicherungsträgers den Wert einer dauerhaften Aufbewahrung haben.
3.2 Abgaben an das Bayerische Hauptstaatsarchiv (im Folgenden: BayHStA)
Die erste Abgabe an das BayHStA erfolgte 2011 (Unfallverzeichnisse und Unfallakten):
Für die Archivierung wurden ausschließlich die älteren Bandverzeichnisse (1893 - 1920 und 1930 - 1945) ausgewählt.
Die Leistungsakten bis einschließlich 1962 beinhalten zum größten Teil "schwere Fälle", während die restlichen Unfallakten aus Datenschutzgründen bereits in der Vergangenheit vernichtet worden waren. Die im Archivierungsvertrag festgelegte Stichprobe "10./11./12.05." wurde bislang ausschließlich auf das Aktenanfallsjahr 2004 angewendet.
Die zweite Abgabe fand 2012 statt und umfasst 145 bzw. 1,40 lfm Mitgliedsakten von Kommunen bei der KUVB (Zeitraum von 1929 bis 1989, teilweise auch bis in die 2000er-Jahre hinein).
3.3 Bestandsgehalt:
Der vorliegende Bestand (14,00 lfm) enthält ausschließlich 141 gebundene Unfallverzeichnisse und 1.168 Unfallakten. Eine Ergänzung des Bestands um weitere, im Archivierungsvertrag festgeschriebene Unterlagen wird angestrebt.
Eine Trennung der Verzeichnisse und Fallakten in die Provenienzen Bayer. GUVV und Bayer. LUK fand nicht statt.
Der Informationsgehalt dieser Verzeichnisse und Einzelfallakten ist höchst sensibel, weswegen ab dem jeweiligen Laufzeitende unbedingt eine 60-Jahres-Sperrfrist (BayArchivG Art. 10 Abs. 3 Satz 5 bzw. § 11 Abs. 3 BArchG) einzuhalten ist. Für den Datenschutz ist zusätzlich die Sperrfrist von 10 Jahren nach dem Tod bzw. - bei nicht feststellbarem Sterbedatum - von 90 (gedrucktes Findmittel) bzw. 110 (Online-Findmittel) Jahren nach der Geburt (Maßgabe des GDS GDA-A1-4142-1/6/3 vom 08.03.2017 in Abweichung von BayArchivG Art. 10 Abs. 3) zu berücksichtigen. Die sensiblen personenbezogenen Daten lassen sich bereits aus dem Findbuch entnehmen, weswegen dieses vom zuständigen Referat "Verbandsschriftgut" bis auf weiteres unter Verschluss gehalten werden muss.
Der Bestand "Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband" wirft Schlaglichter auf das Leben und Arbeiten und auch auf die ärztliche Behandlung von Unfallfolgen der dokumentierten Unfalljahre 1898 - 1962 und 2003/2004.
Die Unfallverzeichnisse geben Auskunft über Vorname, Nachname, Wohnort und in manchen Bänden auch über das Geburtsdatum der verunfallten Person. Man erfährt das Tagesdatum des Unfalls, den Namen des "Betriebsunternehmers", für den der/die Betroffene tätig gewesen ist, die Art der Verletzung und das Unfallgeschehen. Daneben finden sich vor allem in der Spalte "Bemerkungen" Angaben über die Behandlung und gegebenenfalls die Erledigung der Ansprüche. Den Verzeichnissen fehlt jede Form eines alphabetischen Registers.
Die älteren Verzeichnisse sind teilweise in sehr stark beschädigtem Zustand; beim Blättern ist daher unbedingt äußerste Vorsicht und Sorgfalt anzuwenden.
Die im Findbuch chronologisch nach Unfalljahren und dann alphabetisch nach den betroffenen Personen gegliederten Einzelfallakten lassen sich inhaltlich in zwei Gruppen aufteilen:
Die ältere Aktengruppe ()1898 - 1962) wirft Schlaglichter auf das Leben und Arbeiten aber auch auf die ärztliche Behandlung von Unfallfolgen. Es finden sich in den Akten Rentengutachten, Bescheide, Arztberichte, Zahlungsnachweise und vereinzelt Rechnungen über ärztliche Maßnahmen, Heilbehandlungen, Hilfsmittel und Medikamente. Nicht selten sind den ärztlichen Gutachten Röntgenaufnahmen beigefügt. Fallweise sind Regressverfahren bzw. Leistungen an Hinterbliebene dokumentiert. Die eingereichten Rechnungsbelege wurden nur in den Fällen feinkassiert, in denen sie physisch gesondert aufbewahrt wurden, ansonsten wurden sie im Akt belassen.
Die jüngeren Unfall-/BK-Akten (2000 - 2004) hingegen sind im Umfang deutlich schmaler und enthalten vor allem die Unfallanzeige, einen (Durchgangs-)Arztbericht und einzelne Rechnungen über ambulante bzw. stationäre Behandlungen sowie für Rezepte.
Neben diesen mehr äußerlichen Unterschieden fällt auf, dass die jüngeren Einzelfallakten überwiegend Unfälle in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche dokumentieren. Auch handelt es sich überwiegend um Bagatellangelegenheiten im Gegensatz zu den teilweise Leib und Leben schwer beeinträchtigenden Vorfällen aus den Jahren 1898 bis 1962. Diese älteren Fallakten geben zudem einen interessanten Einblick in spezielle Lebensbereiche (Berufskrankheiten infolge der Betreuung von Tuberkulosepatienten, Unfälle im Zusammenhang mit der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, Unfälle bei Hand- und Spanndiensten für die Gemeinde, Forstunfälle und Unfälle infolge von freiwilliger Hilfeleistung bei Unfällen oder infolge eines Eingreifens bei der einen oder anderen für Mitmenschen bedrohlichen Situation). Nicht zu vergessen die Unfälle, die bei der Beseitigung der Kriegsfolgen erlitten wurden, meistens bei Munitionsvernichtung bzw. bei Arbeiten im Auftrag der Staatlichen Erfassungsgesellschaft für öffentliches Gut mbH (STEG) in München, die von 1946/1947 bis 1952 bestand.
Ausschlaggebend für die Verzeichnung der Unfall-/BK[Berufskrankheit]-Akten waren diejenigen Daten, die sich aus den ausgefüllten Formularen der jeweiligen Unfallanzeige, dem Bericht des Durchgangsarztes und dem ersten Bescheid (Rentenfeststellungsbescheid, Sterbegeld- bzw. Hinterbliebenenrentenbescheid) des Leistungsträgers herauslesen lassen. Ergänzend dazu wurde - falls dem Akt zu entnehmen - das Sterbedatum der verunglückten Person ermittelt. Das Findbuch enthält dementsprechend Namen, Vornamen, Beruf, Wohnort und Geburtsdatum / Sterbedatum, dann die Tätigkeit, bei der der Unfall passierte, den Unfallbetrieb und das Unfalldatum.
Die beim Registraturbildner verwendete Registratursignatur bzw. das verwendete alte Aktenzeichen stellt die Verbindung zu dem zugehörigen Unfallverzeichnis her. Auch könnte es ganz generell für statistische Auswertungen nützlich sein: Die ursprünglichen, älteren Geschäftszeichen setzen sich zusammen aus den drei Bestandteilen: Unfallnummer / Unfalljahr / "Säule", wobei "Säule" für die mit einer Zahl codierte Unfallklassifizierung steht (z.B. 8315/1952/410). Auf eine amtliche Konkordanz konnte bei der Verzeichnung zwar nicht zurückgegriffen werden, aber die folgenden Zuordnungen ließen sich ziemlich eindeutig feststellen:
- 310, 330 bzw. 420: Gemeindedienst bzw. Hand- und Spanndienst
- 410: Feuerwehrunfall
- 810: Forstunfall
- 230, 360, 700, 911 bzw. 920: Wegeunfall
Die späteren, neuen Geschäftszeichen verwenden eine abgeänderte Systematik: [in der Bedeutung unbekannte Buchstaben-Zahlen-Kombination] / Unfallnummer / Unfalljahr - [Ergänzungsziffer] (z.B. A-46/8315/52-3).