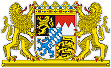Einleitung
Im Rahmen des von der EU geförderten ENArC-Projekts wurde der Urkundenbestand Kloster Landshut-Seligenthal in die Datenbank FAUST aufgenommen, grundlegend überarbeitet und z.T. neu erschlossen. Er umfasst 1563 Urkunden mit einer Laufzeit von 1232-1825. Enthaltene Akten und Urkunden anderer Provenienz wurden im Zuge der Projektabwicklung dem Bestand entnommen.
Überarbeitet wurden die Regesten von Reichsarchiv-Assessor Anton Kalcher, die nach 1877 im Königlichen Kreisarchiv Landshut erstellt wurden. Ab dem Jahr 1500 waren diese Regesten lückenhaft und so wurden etwa 400 Urkunden erstmals regestiert.
Der Urkundenbestand selbst wurde in Folge der Säkularisation 1803 in das Eigentum der kurz zuvor von Ingolstadt nach Landshut verlegten Universität überführt. Trotzdem konnten sämtliche Archivalien zunächst im Kloster verbleiben; nach Auflösung der Universitätsfondsadministration (ab 1870) wurde ein Teil des Klosterarchives dem Universitätsarchiv übergeben, doch blieben viele der Urkunden weiterhin in Seligenthal. Erst im Jahr 1877 konnte von der staatlichen Archivverwaltung eine Herausgabe von über 1000 Urkunden erwirkt werden, die zunächst auf Bestände im Reichsarchiv München, Kreisarchiv Landshut und Universitätsarchiv München aufteilt wurden, bis sie im Zuge der Provenienzbereinigung zu einem gemeinsamen Bestand zusammen geführt wurden.
Das Kloster Seligenthal wurde im Jahr 1232 von der aus dem böhmischen Geschlecht der P?emysliden stammenden bayerischen Herzogin Ludmilla gegründet. Nach dem Mord an ihrem Ehemann Ludwig dem Kelheimer am 15. September 1231 stiftete Ludmilla unter Zustimmung ihres Sohnes Otto II. aus dem Erbe ihrer Eltern auf dem Areal des bereits bestehenden Heilig-Geist-Spitals ein Zisterzienserinnenkloster. Auf Grund der eigenen Herkunft war der Herzogin der Orden der Zisterzienser bekannt, der in Bayern bis dato noch keine bedeutende Verbreitung erfahren hat. Als erstes Zisterzienserkloster in Bayern wurde es daher von den Herzögen protegiert und reich dotiert. Es wird vermutet, dass das Kloster mit Nonnen aus der schlesischen Abtei Trebnitz besiedelt wurde. Die Gemahlin des dortigen Stifters, Hedwig Gräfin von Andechs, lebte zu dieser Zeit selbst in Trebnitz. Ebenso verblieb Ludmilla bis zu ihrem Tod im Jahr 1240 in Seligenthal. Zwei frühgotische Holzfiguren in der klostereigenen Afrakapelle erinnern an das Stifterehepaar. Das hier dargestellte weiß-blaue Rautenwappen, das Ludmilla seit der Heirat mit ihrem ersten Mann Graf Adalbert III. von Bogen im Jahr 1184 führte, wurde zum Symbol der Wittelsbacher und ist heute Bestandteil des bayerischen Landeswappens.
Da sich nach Ludmilla mehrere Wittelsbacher in der Abteikirche Unserer Lieben Frau bestatten ließen, wurde Seligenthal im Verlauf der Jahre zum Hauskloster der Wittelsbacher.
Die ersten Jahre des Klosters Seligenthal waren eng mit dem Heilig-Geist-Spital verbunden. Zunächst bildeten beide Institutionen eine wirtschaftliche Einheit, die erst im Jahr 1252 von Herzog Otto II. voneinander getrennt wurde.
Nachdem dem Kloster schon in der Stiftungsurkunde fünf Ortschaften, allesamt am Hohen Bogen gelegen, nämlich Schwarzenberg, Leiming, Ritzenried, sowie Ober- und Unterfaustern zugesprochen wurden, konnte sich das Kloster auch in den folgenden Jahrzehnten über Stiftungen und Schenkungen freuen, die den Grundbesitz deutlich ansteigen ließen. Innerhalb kürzester Zeit erlangte das Kloster einen weitverstreuten Grundbesitz.
Die zum Teil große Entfernung bereitete Schwierigkeiten in der Verwaltung. Daher versuchte das Kloster durch geschickten Tausch den Besitz zu arrondieren.
Bedeutende Schenkungen erlebte das Kloster vorwiegend im 13. Jahrhundert. So stiftete Herzog Heinrich I. dem Kloster das Dorf Gündlkofen, für das Seligenthal die Hofmarksgerechtigkeit erwarb und das damit verbundene Recht der niederen Gerichtsbarkeit ausübte.
Die großen Schenkungen waren zum Teil nur möglich, weil im 13. Jahrhundert etliche bayerische Grafengeschlechter ausgestorben sind, deren Besitz an die Wittelsbacher fiel, und diese aus ihrem Zuwachs an Besitzungen auch die Klöster bedachten. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts blieb das Vermögen des Klosters beinahe auf gleichem Niveau.
Als erste Äbtissin wurde Agnes von Preysing zu Grünbach (reg. 1233-1277) eingesetzt. Unter ihrer Amtszeit wurde Seligenthal im Jahr 1236 zunächst dem Kloster Kaisheim unterstellt und schließlich etwa zehn Jahre später (1245/46) dem Orden einverleibt. Die erste Kirchweihe erfolgte im Jahr 1259.
Um das Jahr 1260 zählte der Konvent bereits 70 Schwestern und verfügte über ein eigenes Skriptorium. Mit dem Erhalt eines Salzdeputats in Hallein 1331 durfte Seligenthal mit dem herzoglichen Einverständnis Handel betreiben. Ludwig der Bayer nahm das Kloster 1315 und 1341 in seinen Schutz.
Im Verlauf des 15. Jahrhunderts war ein Verfall der Ordenszucht zu beobachten, dem vergeblich durch vermehrte von Raitenhaslach durchgeführte Visitationen entgegengewirkt werden sollte. Um den Untergang des Klosters aufzuhalten, entschloss sich Herzog Ludwig der Reiche, den Konvent von Seligenthal mit Nonnen aus Kloster Königsbrück aufzufüllen.
Im Zeitalter der Reformation kämpfte das Kloster erneut um seinen Bestand. Da der Konvent um das Jahr 1555 nur noch wenige Nonnen zählte, wurde Seligenthal durch das Kloster Niederschönenfeld vor dem Aussterben gerettet.
Während des Dreißigjährigen Krieges mussten die Nonnen Seligenthal in den Jahren 1631 bis 1649 mehrfach verlassen, konnten aber 1651 wieder in die Klostergebäude zurückkehren, die durch den Einfall schwedischer Truppen stark verwüstet waren. In der Folgezeit erwirkte Äbtissin Maria Anna von Preysing (reg. 1643-1665) eine Neugestaltung des religiösen Lebens. Sie legte großen Wert auf eine strikte Einhaltung der Klausur, aber auch auf ein schlichtes Ordensleben, das geprägt war von Sparsamkeit, Entbehrungen und Askese. Zudem sorgte sie für eine wirtschaftliche Konsolidierung des Klosters, schaffte das Amt des Hofmeisters ab und erlaubte erstmals die Aufnahme von Frauen bürgerlichen Standes.
Im Vorfeld der Säkularisation wurde das Kloster ab 1768 mit einem Verbot der Aufnahme von Novizinnen belegt. Auch konnte sich das Kloster durch die Gründung einer Mädchenschule (1782) nicht vor einer drohenden Auflösung retten. Den Aufklärungsbestrebungen der Regierung konnte Seligenthal nicht gerecht werden, so wurde 1801 bereits ein Teil der klösterlichen Einkünfte in das Universitätsvermögen überführt. Schließlich ging 1803 der gesamte Besitz des Klosters in den der Universität über. Die Nonnen konnten jedoch ein Bleiberecht erwirken, so dass das Kloster zwar formal aufgehoben wurde, der Konvent aber bestehen blieb. Bis 1820 wurde der Schulbetrieb aufrechterhalten. Im Jahr 1836 erfolgte die Wiedergründung durch König Ludwig I., 1862 wurde das Kloster Priorat, bis es schließlich 1925 abermals zur Abtei erhoben wurde.
Bei der Bearbeitung der Urkunden waren die vereinzelt auftauchenden kunstvoll geflochtenen Siegelaufhängungen sehr auffällig. Auch die wohl zum Schutz der Siegel angefertigten Siegeltaschen, die teils aus Leder, teils aus Leinen sorgfältig um die anhängende Siegelkapsel genäht wurden, sind eine Besonderheit dieses Bestandes.
Nadine Wickert