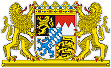Einleitung
Kloster Reisach Urkunden und Kloster Reisach Amtsbücher und Akten
1. Klostergeschichte
Im Jahr 1729 schrieb der kurfürstliche Hofkammerrat Johann Georg von Messerer, der 1721 die Hofmark Urfahrn erworben hatte, an den Provinzial des Karmeliterordens über seine Absicht dort eine Einsiedelei zu stiften. Das Stiftungskapital beinhaltete eine Summe von 16.000 Gulden sowie die kostenlose Überlassung des Baugrundes. Da die deutsche Provinz der Karmeliten bereits einige Klöster, aber noch keine Einsiedelei besaß, nahm der Orden das Angebot freudig an. 1730 erfolgte die Zustimmung des Kurfürsten Karl I. Albrecht und ein Jahr später genehmigte auch das Domkapitel Freising das Vorhaben. Bereits im Oktober 1731 bezogen die ersten Karmeliten das Alte Schloss in Urfahrn (Reisach, Gde. Oberaudorf, Lkr. Rosenheim), das ihnen mitsamt der Kapelle im Neuen Schloss als vorläufige Wirkungsstätte übergeben wurde. Die ausgedehnte seelsorgerische Tätigkeit der Karmeliten ließ es jedoch bald ratsam erscheinen, statt der beabsichtigten Einsiedelei ein Kloster mit großem Gotteshaus zu erbauen. 1732 fand die Grundsteinlegung statt. Die Gebäude wurden nach den Plänen des Münchner Hofbaumeisters Johann Baptist Gunetzrhainer und seines Bruders Ignaz Anton errichtet, die Ausführung lag bei dem einheimischen Maurermeister Abraham Millauer. 1738 konnten die Karmeliten den inzwischen fertig erbauten Konventflügel beziehen, 1747 erfolgte die Weihe der Klosterkirche. 1754 wurden die Sakristei, der Chor und die Bibliothek fertiggestellt. Von 1761 bis 1763 entstand westlich der Klosteranlage ein Gästetrakt, der ab 1851 Sitz des Noviziats wurde.
Die seelsorgerische Tätigkeit der Karmeliten in Urfahrn fand von Anfang an regen Zuspruch in der dort ansässigen Bevölkerung. So verzeichnete das Kloster Urfahrn bis zu 12.000 Kommunionen pro Jahr. Daraus erwuchsen jedoch auch umfangreiche Schwierigkeiten mit den umliegenden Pfarreien, die um ihren Stellenwert und ihre Einnahmen fürchteten. Ab 1768 hatte das Kloster bereits unter den Vorzeichen der Säkularisation zu leiden: Die Karmeliten mussten sich Einschränkungen bei der Zahl der Gottesdienste sowie bei den Beichten, den Kranken- und Armenbesuchen unterwerfen. Auch die Zahl der Feiertage wurde auf kurfürstliches Betreiben eingeschränkt, die Begehung der abgeschafften Feiertage wurde verboten. Am 21. Dezember 1802 verkündete ein Dekret der Kurfürstlichen Spezialkommission in Klostersachen die Aufhebung des Klosters Urfahrn und die weitere Nutzung als "Aussterbekloster" für die Karmeliten aus der Region. Aus Schongau übersiedelten die Mitbrüder des dort aufgehobenen Konvents nach Urfahrn. Das Kloster wurde Staatseigentum, das Stiftungskapital wurde konfisziert. 1835 errichtete König Ludwig I. ein Franziskanerhospiz in Urfahrn, das den Namen "Reisach" erhielt, jedoch noch im selben Jahr in ein Karmelitenvikariat umgewandelt wurde. 1836 wurde das Kloster Reisach durch Karmeliten aus Würzburg wiederbesiedelt, 1851 erfolgten die Erhebung zum Priorat und die Einrichtung des Noviziats für die bayerische Karmelitenordensprovinz.
2. Überlieferung
Im Zuge von Verkaufsverhandlungen, die der Freistaat Bayern mit dem Erzbistum München und Freising bzgl. des Klosters Reisach führte, wurden 2017 die staatseigenen Archivalien, die sich bislang noch im Provinzarchiv der Deutschen Karmeliten in München befanden, an das Bayerische Hauptstaatsarchiv übergeben. Dabei handelte es sich um drei Amtsbücher und 12 Umschlagmappen, in denen sich grob geordnet Akten und Urkunden aus der Zeit bis 1802 befanden. Diese Archivalien konnten in der Folge mit den bereits im Bayerischen Hauptstaatsarchiv verwahrten Archivalien Urfahrner Provenienz vereinigt werden. Letztere wurden den Beständen Kloster Urfahrn Urkunden, KL Urfahrn und KL Faszikel entnommen und zusammen mit der Abgabe aus dem Provinzarchiv der Deutschen Karmeliten zu den beiden provenienzreinen Teilbeständen Kloster Reisach Urkunden und Kloster Reisach Amtsbücher und Akten formiert.
Die Altregistraturvermerke, die auf dem größten Teil der Archivalien vorhanden sind, lassen die ursprüngliche Ordnung der Klosterregistratur erkennen, zeigen aber auch auf, dass die überlieferten Archivalien nur mehr einen Bruchteil der früher vorhandenen Klosterregistratur ausmachen. Zwar ließen sich zahlreiche Vorgänge anhand der Registraturvermerke rekonstruieren, eine Gliederung des Bestandes nach dem System der Klosterregistratur erschien jedoch aufgrund der lückenhaften Überlieferung nicht ratsam. Die Urkunden sind größtenteils als Abschriften vorhanden, die prachtvolle Stiftungsurkunde des Stifterehepaars Johann Georg und Maria Klara von Messerer bildet hier jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme (Signatur: Kloster Reisach Urkunden Nr. 9). Unter den Amtsbüchern befinden sich die Gründungschronik des Klosters Urfahrn mit abschriftlich inserierten Urkunden (Signatur: Kloster Reisach Amtsbücher und Akten Nr. 1) sowie der Bücherkatalog der Klosterbibliothek (Signatur: Kloster Reisach Amtsbücher und Akten Nr. 5). Der Großteil der Akten betrifft die Klosterverwaltung mit der Wirtschaftsführung, der Finanzverwaltung und diversen Rechtsstreitigkeiten des Klosters. Zu den überaus spannenden Bereichen der Klostergründung und des Klosterbaus, des geistlichen Lebens der Klostergemeinschaft, den Auswirkungen der Kriege in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sowie den Folgen von Französischer Revolution und Säkularisation für das Kloster ist jedoch nur mehr wenig überliefert. Bei der Verzeichnung der Akten, Amtsbücher und Urkunden wurde historisch korrekt der zeitgenössische Klostername "Urfahrn" verwendet. Die Teilbestände werden jedoch unter dem Namen "Kloster Reisach" aufgestellt, unter dem das Kloster heute bekannt ist.
3. Ergänzende Bestände
Zum Kloster Urfahrn können noch ergänzend die folgenden Bestände im Bayerischen Hauptstaatsarchiv eingesehen werden: KL Fasz. 777 / 1-14; Kurbayern Hofkammer Archivalien Nr. 3119, Nr. 3120 und Nr. 2942; Kurbayern Landesdirektion von Bayern in Klostersachen Nr. 6743-6758; Kurbayern Geistlicher Rat, Aufsicht über die Klöster Urfahrn 01-Urfahrn 03. In der Plansammlung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs finden sich einige Baupläne und Grundrisse des Klosters Urfahrn, die aus konservatorischen und lagerungstechnischen Gründen den Akten entnommen wurden. Sie sind unter der Signatur Plansammlung Nr. 19808-19815 einsehbar.
4. Literatur
Sinnigen, Ansgar: Katholische Männerorden Deutschlands, Düsseldorf 1934, S. 47.
Reclams Kunstführer Bayern I, S. 812f.
Clemens, Maria: Abriss einer Geschichte des Karmelitenordens und der Klöster der bayerischen Ordensprovinz, Regensburg 1901, S. 37-43.
Altmann, Lothar: Reisach am Inn. Kloster und Kirche der Unbeschuhten Karmeliten, Regensburg 2007 (mit Literaturverzeichnis).