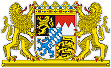Einleitung
1 Die Schule
Die Herzog-Otto-Mittelschule geht in ihren Ursprüngen zurück bis in die Jahre 1803/04 (1), als das Königreich Bayern in den neu erworbenen Gebieten des säkularisierten Hochstifts Bamberg Volksschulen etablierte, um die kurz zuvor eingeführte Unterrichtspflicht für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren durchzusetzen. Lange Zeit im Bereich der katholischen Pfarrkirche angesiedelt, zog die katholische Volksschule Lichtenfels 1887 ebenso wie die wesentlich kleinere protestantische in das neue Schulhaus an der Kronacher Straße (2). Die nun siebenstufige Volkshauptschule war nicht nur nach Konfessionen, sondern auch nach Geschlechtern getrennt. An sie schloss die dreijährige Volksfortbildungsschule (als Sonn- und Feiertagsschule) bzw. seit 1913 eine Berufsfortbildungsschule an. 1923 wurde zunächst übergangsweise bis 1927 an der Volkshauptschule eine 8. Klasse eingeführt, bevor dann 1933 unter der nationalsozialistischen Regierung die kombinierte Volkshaupt- und Volksfortbildungsschule endgültig durch die achtstufige Volksschule ersetzt wurde.
Im Zuge der Schulreformen der 1960er Jahre wurden die Volksschulen allgemein einem deutlichen Wandel unterworfen. Zunächst verfügte das Schulverbandsgesetz von 1961 die Zusammenlegung von oft nur ein- oder zweiklassigen Landschulen in einem Zentrum. 1966 strukturierte das Volksschulgesetz die Volksschule in vierjährige Grundschule und ebenso lange Hauptschule und forderte nochmals die Zusammenlegung unzureichend strukturierter Schulen in nach Jahrgangsklassen gegliederte Verbandsschulen. 1968 wurde per Volksentscheid die konfessionelle Bekenntnisschule zugunsten der christlichen Gemeinschaftsschule aufgegeben und ein Jahr später das neunte Schuljahr eingeführt. (3)
Für die katholische Volksschule Lichtenfels bedeutete dies, dass sie mit dem Schuljahr 1969/70 zur 5-jährigen gemischtkonfessionellen Hauptschule umgewandelt wurde. Als Zentrum des neuen Schulverbands hatte sie dabei zunächst noch Zweigstellen in den alten Landschulen Mistelfeld, Kösten, Schney, Stetten und Trieb. Erst als 1974 das neue Schulzentrum an der Friedenslinde die Raumnot behob, konnte die neue Hauptschule Lichtenfels als Herzog-Otto-Schule (benannt nach Herzog Otto I. von Andechs-Meranien) eingeweiht werden. Seit 1999/2000 bietet die Herzog-Otto-Schule den Mittlere-Reife-Zug an, der in der 10. Klasse mit der Mittleren Reife endet. Seit 2011 heißt sie Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels.
Als bekanntester Schüler darf der ehemalige Bundesjustizminister (1949-1953) sowie Bundes- und Fraktionsvorsitzender der FDP (1953-1957), Thomas Dehler, einer der "Väter des Grundgesetzes", gelten, der die katholische Volksschule 1904 bis 1907 besuchte. (4)
2 Überlieferungsgeschichte
Mit der Zusammenlegung der verschiedenen Volksschulen in dem neuen Schulzentrum fanden auch die Schülerakten der umliegenden Landschulen ihren Weg in die Herzog-Otto-Schule, so dass nun verschiedenste Vorprovenienzen auftauchen
- Volksschule Mistelfeld
- Volksschule Hochstadt "Oberes Maintal
- Volksschule Kösten
- Volksschule Schney
- Volksschule Stetten
- Volksschule Trieb
- katholische Volksschule Lichtenfels
- evangelische Volksschule Lichtenfels
- Hauptschule Lichtenfels mit Zweigstellen in Mistelfeld, Kösten, Schney, Stetten und Trieb
- Herzog-Otto-Schule Lichtenfels
- landwirtschaftliche Berufsschulen in Stetten (2-stufig)
- ländliche Berufsschule Lichtenfels
- ländliche Berufsschuel Mistelfeld
- Volksfortbildungsschule Lichtenfels
- Volksfortbildungsschule Mistelfeld.
Da sich während der im Vorfeld 2016 erlassenen Archivierungsvereinbarung zu Schülerunterlagen durch Dr. Hannah Hien und Dr. Klaus Rupprecht durchgeführten Recherchen herausstellte, dass die Überlieferung der Herzog-Otto-Mittelschule und ihrer Vorgängerschulen vergleichsweise weit zurückreicht und recht umfangreich ist, wurde die Schule in das Auswahlmodell der anbietungspflichtigen Schulen übernommen. Eine Aktenanbietung seitens der Schule erfolgte schnell und betraf nicht nur die Schülerakten, sondern auch Verwaltungsakten. Sie wurden nach einer ersten durch Dr. Hannah Hien durchgeführten Bewertung im Herbst 2016 übernommen.
3 Bestand und Findbuch
Der Bestand umfasst 607 Archivalieneinheiten mit einer Laufzeit von 1844 bis 2002. Die ältesten Dokumente sind sogenannte Notizenbücher der Volksschulen Mistelfeld und Trieb, in denen die wichtigsten Ereignisse des jeweiligen Schuljahres, u.a. Visitationen durch den Lokalschulinspektor, festgehalten wurden. Mit dem Jahr 1871 setzen dann die Schülerunterlagen ein, zunächst der Volksschule Mistelfeld, seit 1900 auch der Volksschule Lichtenfels und seit 1903 der Volksschule Kösten. Dabei wurden bis 1918/19 Zensurbögen geführt, die in einer Übergangszeit durch Schülerbögen ergänzt wurden. Seit 1933 wurden nur noch Schülerbögen angelegt, die durch Beigabe von Gesundheitsbögen, Zeugnisabschriften, Mitteilungen an die Eltern etc. zu einer Schülerakte anwuchsen.
Schülerlisten, wie sie auch heute noch für Mittelschulen typisch sind, sind nach Klassen angelegt und seit 1928 erhalten. Seit ca. 1980 enthalten sie nur noch die Grunddaten jedes Schüler (Name, Geburtsdatum, Anschrift) sowie die Fehltage. Sie wurden daher als nicht archivwürdig bewertet und vernichtet.
Verwaltungsakten sind seit 1956 überliefert. Sie wurden im Wesentlichen als jahrgangsweise Korrespondenzakten angelgt, d.h. nicht nach sachbezogenem Aktenplan, sondern nach Korrespondenzpartnern. Typischerweise finden sich in der Korrespondenz mit einem bestimmten Partner immer dieselben Betreffe, z.B. in der "Korrespondenz mit Lehrern" v.a. Dienstbefreiungen, Fortbildungen, Quittungen u.ä. Dieses Schema kann in Ausnahmefällen durchaus durchbrochen werden, so dass sich eine völlig andere Angelegenheit in der Akte befindet. Eine konsistente Bewertung wurde auf diese Weise erschwert, so dass jede Akte durchgesehen werden musste. Als archivwürdig wurden schließlich die Akten zur Korrespondenz mit dem Schulamt bewertet - die ältere Überlieferung des Schulamts Lichtenfels ist fast vollständig verloren - , sowie zu Festen, Schulfeiern und Spendensammlungen, zu "Schülerbelangen" (v.a. Disziplinarfälle), in Ausnahmefällen auch die Korrespondenz mit Eltern (Elternabend, Elternvertretung, Schulforum), Vereinen, Verbänden und Zeitschriften. Nur exemplarisch wurden dokumentiert:
- Korrespondenz mit Behörden und anderen Schulen (v.a. Bitten um Übersendung von Schülerbögen)
- Korrespondenz mit Lehrern (v.a. Dienstbefreiungen, Fortbildungen, Quittungen)
- Korrespondenz mit der Stadtverwaltung (v.a. Haushaltssachen, Abrechnungen)
- Dienstantritts- und -beendigungsmeldungen
- Krank- und Gesundmeldungen
- Gesundheitsuntersuchungen
- Schüler Zu- und Abgänge (Überweisungsscheine).
Die übernommenen Akten wurden nach dem Aktenplan für Volksschulen von 1951 völlig neu strukturiert. Ein Großteil des Bestands ist aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen gesperrt und darf nicht vorgelegt werden.
4 Ergänzende Überlieferung
Verwiesen sei hier auf die Überlieferung der Regierung von Oberfranken und des Landratsamts Lichtenfels, die die mittlere Schulaufsicht innehatten bzw. für Personal und Sachaufwand zuständig waren. Die Überlieferung des Schulamts Lichtenfels und seiner Vorgängerbehörden ist wie gesagt stark dezimiert.
5 Literaturhinweise
(1) StABa, Reg. v. Ofr., Kammer der Finanzen (K 200, 4), Nr. 16443.
(2) Dippold, Günter: Das Lichtenfelser Zentralschulhaus. Bau und Geschichte. Festrede am 30.11.2012 [http://www.rossbach-grundschule-lichtenfels.de/index_htm_files/entwicklung.pdf, 10.08.2017].
(3) Buchinger, Hubert: Die bayerische Volksschule im Wandel der Zeit. Ein Beitrag zur Schulgeschichte Bayerns von 1800 bis zur Gegenwart, in: Regensburger Land 1 (2008), S. 109 - 124. Auch Seibert, Norbert: Die Geschichte des Bayerischen Bildungswesens von 1964 bis 1990, in: Handbuch der Geschichte des Bayerischen Bildungswesens, hg. von Max Liedtke. 4 Bde. Bad Heilbrunn, Bd. 3, S. 747-841 und Wiater, Werner: Die Geschichte der Verbandsschulen in Bayern, in: ebd., S. 842-856.
(4) Wengst, Udo: Art. Dehler, Thomas, in: Biographisches Handbuch der Mitglieder des Deutschen Bundestages 1949-2002, hg. von Rudolf Vierhaus. 2 Bde. München 2002/2003, Bd. 1, S. 137.
Dr. Johannes Staudenmaier, August 2017
- Aktenplan für die Grund- und Volksschulen (1951)
- 0 Schule im allgemeinen
- 1 Schulhaus
- 10 Schulgrundstück, Schulgebäude (auch Beflaggung), Schulgarten, Turn- und Sportplatz; Schulhausbau
- 11 Schulräume: Klasszimmer (auch Verteilung), Fachunterrichtsräume, Schulleiter-, Arzt-, Lehrerzimmer, Turnsäle, Ausweichräume, Schulbad, Aborte usw.
- 15 Personal: Offizianten, Hausmeister; Heizer, Reinigungsfrau usw.
- 2 Schüler
- 20 Schuleintritt, Einschreibung, Zurückstellung, Gast- und Wanderschüler, körperlich und geistig behinderte Schüler
- 22 Zu- und Abgang, Übertritt an Mittelschulen, höhere Schulen und Berufsschulen (auch Schulgrundbücher); Schulentlassung
- 23 Schülerbögen und -listen; Schülerbenotung, Schulzeugnisse, Zeugnisgebühren, Vorrücken
- 24 Gesundheitspflege: Schulärztliche Untersuchungen, Bestimmungen über Gesundheitsbogen und -karten, Zahnpflege; ansteckende Krankheiten; Impfungen; Unfälle; Unfallverhütung; Schülerversicherung; Schülerspeisung
- 3 Lehrkräfte
- 4 Schulleitung
- 5 Schulaufsicht
- 6 Unterricht
- 7 Erziehung
- 8 Schule und Öffentlichkeit